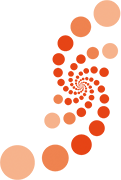Energie & Landwirtschaft
Ein wesentlicher Tätigkeitsschwerpunkt des Netzwerkes SolarInput ist „Strom für die Landwirtschaft“ (AGRI-PHOTOVOLTAIK) mit spezieller Expertise in Technik, Gartenbau und Pflanzenkulturen. Hier erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit Frau Prof. Kerstin Wydra Fachgebiet „Pflanzenproduktion im Klimawandel“ von der FH Erfurt / Vorstand SolarInput.
AGRI-PHOTOVOLTAIK – WAS IST DAS EIGENTLICH?
Agri-Photovoltaik (auch Agriphotovoltaik oder Agrophotovoltaik; kurz Agri-PV oder APV) wird das System der Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Flächen zur gleichzeitigen Produktion von Nahrungsmitteln und Strom genannt. Dafür werden Photovoltaikanlagen (PV) auf Acker- oder Grünland so installiert, dass die Pflanzen weiterhin genug Licht für die Photosynthese und Ertragsbildung erhalten und Pflanzen und Boden sogar von der Beschattung profitieren. Dabei bleibt die Bearbeitung mit landwirtschaftlichem Gerät weiterhin möglich und gleichzeitig wird auf dieser Fläche durch die PV-Anlagen viel Strom erzeugt. Im Vordergrund steht dabei immer die Landwirtschaft und erst danach die Solarwirtschaft.
Mehr Informationen zum Thema Agri-PV gibt es hier:
„NICHT AUF MEINEN GUTEN BÖDEN!“
WAS IST ALLES APV? oder KEINE PSEUDO-LANDWIRTSCHAFT FÖRDERN!
WELCHE PFLANZENKULTUREN EIGNEN SICH FÜR APV?
WAS MÜSSEN WIR TUN? oder WIE DER MARKTHOCHLAUF GELINGT
WAS WIR TUN:
Unter der Leitung von Frau Prof. Kerstin Wydra arbeiten wir an der Umsetzung erster Forschungs- und Demonstrationsprojekte zur Kombination von Photovoltaik und Landwirtschaft in Thüringen. In diesem Zug sind die Projekte “AgriPV-Thue” am 01. August 2023 und das Projekt “BeerenKlima” am 01. Juli 2023 gestartet.
Weiterhin stehen wir in einem fortwährenden Dialog mit der politischen Ebene zur Unterstützung der Energiewende und dem Ausbau durch die Photovoltaik. In der Zusammenarbeit mit den Landwirt:innen wird die PV-technologische Kernkompetenz mit dem Anbau möglicher Pflanzenkulturen verknüpft. Somit arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft und Solarenergie. Daher bietet unser Netzwerk die Möglichkeit der Beratung und Vernetzung von APV-Interessierten mit Akteuren aus der Region.
Eine Potentialanalyse zu geeigneten Flächen in Thüringen wurde im Februar 2022 erstellt und gibt einen ersten Überblick und Empfehlungen an die Politik zur Unterstützung von APV-Anlagen (Download hier).
Sie sind an der Installation einer Agri-Photovoltaik-Anlage in Thüringen interessiert?
Die Geschäftsstelle des SolarInput e.V. beantwortet Ihnen gerne Fragen rund um das Thema Agri-Photovoltaik und unterstützt Sie bei der Realisierung.
Kontakt: SolarInput e.V., Tel.: +49 (0) 160 87 09 668, info@solarinput.de