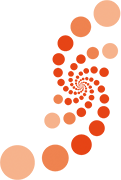Neues aus der Forschung
Neue Studie belegt: Zubau von 140 GW PV-Kleinanlagen bis 2030 möglich
(Quelle: Pressemeldung Elektrizitätswerke Schönau (EWS), 21.09.2020)
In den kommenden zehn Jahren ist ein massiver Ausbau insbesondere von «kleiner Photovoltaik» nötig und möglich. Bis 2030 kann vornehmlich mit Dachanlagen ein Zubau auf bis zu 140 Gigawatt Leistung realisiert werden. Mit diesem neuen Bürgerenergie-Boom würden die drohende Ökostromlücke verhindert und die Klimaschutzziele erreicht. Dies sind die zentralen Ergebnisse einer von EWS initiierten Studie des Analysehauses Energy Brainpool. (mehr …)
Höhere Wirkungsgrade bei Organischer Photovoltaik – neuer Solarzellenrekord auf 1 cm2
(Quelle: Presseinformation Fraunhofer ISE, 24.09.2020)
Die Forschung im Bereich der Organischen Photovoltaik arbeitet mit Nachdruck daran, die Wirkungsgrade weiter zu erhöhen. Neue Materialien aus der synthetischen organischen Chemie haben in den letzten Jahren deutliche Steigerungen des Wirkungsgrads ermöglicht. Eine der Herausforderungen ist dabei, die oftmals auf sehr kleinen Laborzellen erzielten Werte auf größere Flächen zu übertragen. Das Fraunhofer ISE verzeichnet jetzt zusammen mit dem Freiburger Materialforschungszentrum FMF der Universität Freiburg mit 14,9% einen Rekordwert für organische Solarzellen mit mindestens 1 cm2 Fläche – ein wichtiger Schritt für die Weiterentwicklung dieser kostengünstigen Technologie hin zu einer breiten Anwendungsreife. (mehr …)
IEA: Das Erreichen von Energie- und Klimazielen erfordert eine dramatische Ausweitung sauberer Energietechnologien – ab sofort
(Quelle: Pressemitteilung IEA, 10.09.2020)
Die Umgestaltung des Energiesektors allein wird der Welt nur ein Drittel des Weges zur Netto-Null-Emission ermöglichen, heißt es in dem neuen Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA), in dem die Notwendigkeit größerer Anstrengungen in anderen Schlüsselsektoren hervorgehoben wird. (mehr …)
Klimaschäden für unsere Wirtschaft: Studie zeigt höhere Kosten als erwartet
(Quelle: Pressemitteilung PIK, 19.08.2020)
Steigende Temperaturen durch den Ausstoß von Treibhausgasen können unserer Wirtschaft größeren Schaden zufügen als frühere Untersuchungen vermuten ließen – das zeigt eine neue Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) und des Mercator Research Institute for Global Commons and Climate Change (MCC). Die Wissenschaftler haben auf der Grundlage eines in dieser Form erstmals entwickelten Datensatzes des MCC genauer untersucht, wie sich der Klimawandel auf Gebiete wie etwa US-Bundesstaaten, chinesische Provinzen oder französische Départements auswirkt, also unterhalb der nationalstaatlichen Ebene. Wenn die CO2-Emissionen aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe nicht umgehend reduziert werden, kann eine globale Erwärmung um 4°C bis 2100 dazu führen, dass diese Regionen im Durchschnitt fast 10% ihrer Wirtschaftsleistung verlieren, und in den Tropen sogar mehr als 20%. (mehr …)
Fraunhofer ISE erreicht neuen Wirkungsgradrekord mit Solarzellen im Tandem
(Quelle: Pressemitteilung Fraunhofer ISE, 10.08.2020)
Die Photovoltaikforschung arbeitet mit Nachdruck daran, die Wirkungsgrade von Solarzellen immer weiter zu erhöhen. Zunehmend rückt die Tandem-Photovoltaik dabei in den Fokus, bei der in unterschiedlichen Kombinationen leistungsstarke Solarzellenmaterialien zusammengeführt werden, um so das Sonnenspektrum bei der Umwandlung von Licht in elektrische Energie noch effizienter zu nutzen. Das Fraunhofer ISE verzeichnet jetzt mit 25,9 Prozent Wirkungsgrad einen neuen Rekordwert für eine direkt auf Silicium gewachsene III-V/Si Tandemsolarzelle. Diese wurde erstmals auf einem kostengünstigen Siliciumsubstrat hergestellt – ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu wirtschaftlichen Lösungen für die Tandem-Photovoltaik. (mehr …)
Neue Solarzellen für den Weltraum
(Quelle: Pressemitteilung TUM, 13.08.2020)
Perowskit- und organische Solarzellen bewähren sich auf Raketenflug im All
Nahezu alle Satelliten beziehen ihren Strom aus Solarzellen. Doch die sind schwer. Herkömmliche Hochleistungszellen liefern bis zu drei Watt pro Gramm. Perowskit- und organische Hybridzellen könnten bis zum Zehnfachen liefern. Erstmals hat nun ein Forschungsteam der Technischen Universität München (TUM) und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) solche Zellen im Weltraum getestet. (mehr …)
ZSW will kritische Rohstoffe aus Lithium-Ionen-Batterien recyceln
(Quelle: Pressemitteilung ZSW, 19.08.2020)
ZSW untersucht Wiederaufbereitung von Kobalt, Lithium und Naturgrafit für neue Zellen
Die steigende Nachfrage nach großen Lithium-Ionen-Batterien für den Verkehrs- und Energiesektor führt zu einem sehr schnell ansteigenden Bedarf an Rohstoffen. Manche werden von der Europäischen Union als kritisch eingestuft, etwa Kobalt, Lithium und Naturgraphit. Die heute verfügbaren Recyclingverfahren gewinnen allerdings bislang nur einige Metalle zurück. Lithium wird überhaupt nicht recycelt. Damit künftig bei der Rohstoffversorgung keine Engpässe und Preisrisiken entstehen, prüft das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) in dem neuen Projekt RecycleMat wie sich Batterieelektroden wiederaufarbeiten lassen, so dass Materialien möglichst vollständig rückgewonnen und direkt als Rohstoff für die Herstellung neuer Elektrodenmassen eingesetzt werden können. Das baden-württembergische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau fördert die Studie über zwei Jahre. Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut übergab dem ZSW heute den Förderbescheid über 870 000 Euro. (mehr …)
IASS Studie: Kleinteilige Lösungen für grünen Strom nur wenig teurer als zentralisiertes System
(Quelle: Pressemitteilung IASS, 14.08.2020)
Bis 2050 soll Europa ein klimaneutraler Kontinent werden. Dafür muss der Strom weitgehend aus erneuerbaren Energien stammen. Die Umsetzung der Energiewende wird kontrovers diskutiert: Als preisgünstigste Lösung gilt eine Konzentration der Energieerzeugung an den geeignetsten Standorten des Kontinents, viele Bürgerinnen und Bürger favorisieren allerdings kleinere Versorgungsnetze. Laut einer Studie von Wissenschaftlern aus Potsdam und Zürich sind diese gegen überschaubare Mehrkosten möglich. (mehr …)
UN-Klimaziele sind ökonomisch sinnvoll: Ambitionierter Klimaschutz zahlt sich aus
(Quelle: Pressemitteilung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 13.07.2020)
Klimaschutz ist nicht billig – aber Klimaschäden sind es auch nicht. Wie viel Klimaschutz ist also wirtschaftlich gesehen am sinnvollsten? Diese Frage hat Ökonomen jahrzehntelang beschäftigt, insbesondere seit dem Wirtschaftsnobelpreis 2018 für William Nordhaus, dessen Berechnungen nach eine Erwärmung um 3,5 Grad bis 2100 ein ökonomisch wünschenswertes Ergebnis sei. Ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung hat nun die Computersimulation, die diesen Schluss gezogen hat, mit den neuesten Daten und Erkenntnissen aus Klima- und Wirtschaftswissenschaften aktualisiert. Sie stellten fest, dass die Begrenzung der Erderwärmung auf unter 2 Grad ein wirtschaftlich optimales Gleichgewicht zwischen künftigen Klimaschäden und den heutigen Kosten für den Klimaschutz herstellt. Das würde einen CO2-Preis von mehr als 100 US-Dollar pro Tonne erfordern. (mehr …)
Tulane-Wissenschaftler bauen leistungsstarke Hybrid-Solarenergiekonverter
(Quelle: Pressemitteilung Tulane University, 15.07.2020)
Forscher der Tulane University sind Teil eines Wissenschaftlerteams, das einen hybriden Solarenergiekonverter entwickelt hat, der Strom und Dampf mit hohem Wirkungsgrad und geringen Kosten erzeugt. (mehr …)
<< Zurück zu "Alle Meldungen"