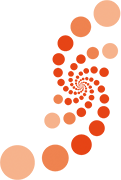Nationale Nachrichten
PV-Industrie in Deutschland – Matchmaking für den Hochlauf bringt Unternehmen zusammen
Rund hundert Akteurinnen und Akteure der Photovoltaikbranche fanden sich am Montag im Fraunhofer ENIQ – der Repräsentanz der Fraunhofer-Energieforschung in Berlin – zusammen, um über mögliche Kooperationen für neue PV-Produktionen in Deutschland zu diskutieren. Anlass ist ein Interessenbekundungsverfahren, ausgeschrieben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), für das sich Interessierte an einer Investitionskostenförderung bis zum 15. August 2023 bewerben können. 12 Unternehmen stellten im Rahmen des Workshops unterschiedliche Projektskizzen für PV-Fertigungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette vor. Einige von ihnen werden in Konsortien ihre Interessenbekundungen beim BMWK einreichen.
Expertenrat für Klimafragen stellt Bericht zum Klimaschutzprogramm vor
Am 22. August hat der Expertenrat für Klimafragen seine Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung veröffentlicht. Der im September 2020 berufene Expertenrat berät die Bundesregierung bei der Anwendung des Bundes-Klimaschutzgesetzes. Das unabhängige Expertengremium setzt sich aus fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, Vorsitzender ist Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und Professor für Solare Energiesysteme an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Zusätzliche Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele notwendig
Der vom Umweltbundesamt (UBA) koordinierte Projektionsbericht 2023 der Bundesregierung analysiert die aktuelle Klimaschutzpolitik. Der Bericht zeigt, dass das Erreichen der nationalen Klimaziele bis 2030 und 2045 ohne zusätzliche Maßnahmen gefährdet ist. Auch wenn die Gesamtlücke im Vergleich zur vorherigen Projektion um 70 Prozent reduziert werden konnte, beträgt sie bis zum Jahr 2030 immer noch 331 Mio. Tonnen klimaschädliche Treibhausgasemissionen. Die Lücke wird auch durch bereits geplante Maßnahmen nicht vollständig geschlossen. Das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 würde unter den gegebenen Umständen nicht erreicht.
Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen Planungsstand für deutschlandweites Wasserstoff-Kernnetz – Erster wichtiger Schritt für die künftige Wasserstoff-Infrastruktur
Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) haben ihren aktuellen Planungsstand für das künftige überregionale Wasserstoff-Kernnetz an das BMWK und die Bundesnetzagentur übergeben. Damit ist ein erster wichtiger Schritt für die Planung des Wasserstoffnetzes in Deutschland getan. Wasserstoff ist zentral, um wichtige Industriezweige auf dem Weg zur Klimaneutralität zu dekarbonisieren. Daher muss auch die notwendige Infrastruktur von Anfang an mitgedacht werden.
Markthochlauf für Wasserstoff beschleunigen – Bundeskabinett beschließt Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie Einleitung
Das Bundeskabinett hat heute die Fortschreibung der Nationalen Wasserstoffstrategie beschlossen. Der Beschlussfassung im Kabinett vorausgegangen war eine politische Einigung aller Ressorts, inkl. der fünf Kernressorts für Wasserstoff, d.h. des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, des Bundesentwicklungsministeriums, des Bundesverkehrsministeriums und des Bundesforschungsministeriums. Die Nationale Wasserstoffstrategie aus dem Jahr 2020 hat grundsätzlich weiter Bestand, wird nun aber mit der Fortschreibung an das gesteigerte Ambitionsniveau im Klimaschutz und die neuen Herausforderungen am Energiemarkt weiterentwickelt. Sie setzt staatliche Leitplanken für die Erzeugung, den Transport und die Nutzung von Wasserstoff und seinen Derivaten und bündelt die Maßnahmen der Bundesregierung. Eine zuverlässige Versorgung Deutschlands mit grünem, auf Dauer nachhaltigem Wasserstoff ist dabei erklärtes Ziel der Bundesregierung.
Habeck und Neubaur: Förderzusage für 2-Milliarden- Euro für größtes Dekarbonisierungsprojekt in Deutschland
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck und die NRW-Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur besuchen heute gemeinsam thyssenkrupp in Duisburg, um vor Ort die 2 Milliarden Euro Förderzusage von Bund und Land zu übermitteln. In der vergangenen Woche hat die Europäische Kommission grünes Licht für das größte Dekarbonisierungsprojekt in Deutschland gegeben. Damit ist der Weg frei für das zentrale Projekt „tkH2steel“ der thyssenkrupp Steel Europe AG und damit für die Transformation der deutschen Stahlindustrie hin zur Klimaneutralität. Durch die Teil-Umrüstung des größten europäischen Stahlhüttenwerks und die Umstellung der Fertigung auf Wasserstoff sollen jährlich bis zu 3,5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen eingespart werden. Das Unternehmen plant hierfür Investitionen von knapp drei Milliarden Euro.
Solarpaket 1: Habeck: „Mehr Tempo und weniger Bürokratie beim Solarausbau“ – Solarpaket steckt Kurs ab für Verdreifachung des Zubautempos
Die Bundesregierung hat heute im Kabinett das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) vorgelegte Solarpaket beschlossen. Die Maßnahmen beschleunigen den Ausbau der Photovoltaik vor dem Hintergrund der ambitionierten PV-Ausbauziele bis 2030. Das Gesetzespaket basiert auf einem umfangreichen Konsultationsprozess mit der Branche, aber auch mittels Bürgerbeteiligung und setzt zentrale Elemente der Photovoltaikstrategie um, die das BMWK im Mai 2023 vorgestellt hatte. Zugleich ist das Solarpaket ein positives Beispiel für Bürokratieabbau. Durch einen dem Erarbeitungsprozess vorausgegangenen Praxis-Check wurden Hemmnisse und Bürokratiehürden aufgespürt und im Gesetzespaket konkret abgebaut.
Mehr als 9.000 Solaranlagen sind im ersten Halbjahr 2023 in Betrieb gegangen
Die Zahl der Solaranlagen in Thüringen hat sich seit Beginn des Jahres um rund 9.256 Stück erhöht. Wie eine Auswertung der Landesenergieagentur ThEGA zeigt, haben zum 30. Juni 2023 insgesamt rund 56.571 Solaranlagen im Freistaat klimafreundlichen Strom erzeugt. Vor einem Jahr waren es thüringenweit 41.600 PV-Anlagen. Gemessen an der Einwohnerzahl sind in Thüringen durchschnittlich 27 Photovoltaikanlagen auf 1.000 Einwohner installiert.
Energiewende: Minister Stengele übergibt Zertifikate für erfolgreiches Energiemanagement an vier Thüringer Kommunen
Stengele: „Wenn wir in 20 Jahren klimaneutral sein wollen, müssen wir jetzt die Weichen richtig stellen“: Vier Thüringer Kommunen haben in Eisenach ein Zertifikat für vorbildliches Energiemanagement erhalten. Thüringens Energieminister Bernhard Stengele überreichte die Urkunden an die Landkreise Unstrut-Hainich, Saalfeld-Rudolstadt und Eichsfeld sowie die Stadt Eisenach.
45 Millionen für Erprobung von Wasserstoff in der Luftfahrt
Luft- und Raumfahrtkoordinatorin übergibt Förderbescheid für fliegendes Wasserstofflabor: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz BMWK fördert mit 45,2 Millionen Euro die Beschaffung eines Regionalflugzeugs sowie dessen Umrüstung und Nutzung als fliegender Wasserstoff-Prüfstand (Flying Testbed). Den entsprechenden Förderbescheid hat die Koordinatorin der Bundesregierung für die Deutsche Luft- und Raumfahrt, Dr. Anna Christmann, heute an die Vorstandvorsitzende des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), Professor Dr.–Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, übergeben.
<< Zurück zu "Alle Meldungen"