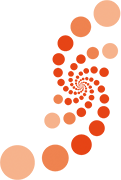Nationale Nachrichten
Bundeskabinett beschließt Gesetzentwurf zur Schaffung eines Wasserstoff-Kernnetzes Einleitung
Das Bundeskabinett hat heute mit der aktuellen Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) Regelungen zum rechtlichen und regulatorischen Rahmen eines zukünftigen Wasserstoff-Kernnetzes in Deutschland beschlossen.
Habeck: Wichtiges Klimapaket geht in die Ressortabstimmung
Entwürfe zum Klimaschutzgesetz und zum Klimaschutzprogramm an Ressorts übermittelt: Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat heute Nachmittag die Ressortabstimmung zum Entwurf des Klimaschutzgesetzes und des Klimaschutzprogramms eingeleitet.
3-millionste Solarstromanlage installiert
Inbetriebnahme der 3-millionsten Solarstromanlage – Solarstromleistung in Deutschland 70-Gigawattmarke überschritten – besonders bei Privathaushalten boomt die Nachfrage – mehr als doppelt so viele Solarstromanlagen auf Eigenheimen im ersten Quartal diesen Jahres als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum
Veranstaltungshinweis: Vorstellung der neuen Förderrichtlinie GreenInvest Ress
Wann: 31.05.23 (14:00 – 15:30 Uhr) oder 19.06.23 (10:00 – 11:30 Uhr)
Wo: online
Im Rahmen der Veranstaltung stellen das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz sowie die Thüringer Aufbaubank und die Servicestelle Ressourcenschonung der ThEGA das neue Förderprogramm zur Ressourceneffizienz in Thüringen, GreenInvest Ress vor. Im Anschluss an die Vorstellung ist ausreichend Raum für Fragen eingeplant.
Zweiter PV-Gipfel im Bundeswirtschaftsministerium: PV Strategie vorgelegt
Bundesminister Habeck: „Wir brauchen mehr Tempo beim Ausbau der Solarenergie“:
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck hat im Rahmen des zweiten PV-Gipfels eine umfassende Photovoltaik-Strategie vorgelegt. Ziel ist es, den Ausbau der Solarenergie in Deutschland erheblich zu beschleunigen. Dazu benennt die Strategie Maßnahmen in insgesamt elf Handlungsfeldern. Das Spektrum reicht von Maßnahmen im Bereich der Energiepolitik bis hin zu den Themen Fachkräftesicherung, industrielle Wertschöpfung in Europa und Technologieentwicklung. Vorausgegangen war ein erster PV-Gipfel im März 2023. Seit März wurde die PV-Strategie konsultiert. Es gingen mehr als 600 Stellungnahmen hierzu ein.
Habecks 1. Photovoltaik-Gipfel
Solarwirtschaft begrüßt BMWK-Vorhaben zum Abbau von Bürokratie und Marktbarrieren und will jährlich installierte PV-Leistung in vier Jahren verdreifachen:
Ostdeutsche Solarbranche diskutiert über Clustergründung
Auf Initiative der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland, des Fraunhofer-Centers für Silizium-Photovoltaik CSP und der Hochschule Anhalt trafen sich heute rund 40 Akteure der ostdeutschen Solarbranche und Vertreter der Länder Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und Brandenburg in Halle (Saale). Im Mittelpunkt des Workshops standen die Wertschöpfungspotenziale der Solarwirtschaft und die Möglichkeiten der institutionellen, länderübergreifenden Zusammenarbeit.
Klimaneutrales Energiesystem bis 2050: kontinuierlicher PV-Ausbau während der nächsten 10 Jahre erforderlich
Expertinnen und Experten der Solarenergie weltweit zeigen auf, dass das Wachstum der Photovoltaik in den nächsten 10 Jahren kontinuierlich fortgesetzt werden muss, um den globalen Energie-Bedarf 2050 klimaneutral zu decken. Sie argumentieren, dass es keine Option mehr sei, Wachstumsprognosen für PV abzusenken und stattdessen auf andere Energiequellen oder das Eintreten technologischer Wunder in letzter Minute zu warten. In einer gemeinsamen Veröffentlichung, die am 7. April 2023 in der neuesten Ausgabe von »Science« publiziert wurde, kommen die PV-Forscherinnen und Forscher zu dem Schluss, dass ein weltweiter Ausbau der Photovoltaik von 25 Prozent pro Jahr über die nächsten zehn Jahre die Voraussetzung für ein global klimaneutrales Energiesystem bis 2050 sei. Der vollständige Artikel kann unter https://www.science.org/stoken/author-tokens/ST-1121/full abgerufen werden.
Wärmewende: Energieministerium Partner im “Gebäudeforum klimaneutral” der Deutschen Energieagentur dena
Thüringens Gebäudebestand soll bis 2045 klimaneutral werden. Für das Erreichen dieses Zieles geht das Thüringer Energieministerium als erstes Landesressort eine strategische Partnerschaft mit der Deutschen Energieagentur (dena) ein. Im „Gebäudeforum klimaneutral“ geht es vor allem um Wissenstransfer für Klimaneutralität in Gebäuden und Quartieren.
Wärmewende: Erster klimaneutraler Plattenbau Thüringens in Stadtroda
Es ist das erste Projekt dieser Größenordnung in Thüringen und steht kurz vor der Fertigstellung: Ein DDR-Plattenbau in Stadtroda mit 144 Wohnungen wird klimaneutral! Dafür sorgt u.a. eine neuartige Wärmerückgewinnung aus dem Brauchwasser von Waschmaschine oder Badewanne. Energieminister Bernhard Stengele besuchte heute die Baustelle.
<< Zurück zu "Alle Meldungen"