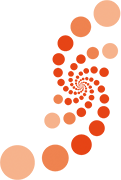Aktuelle Informationen
Effiziente Großserienfertigung von Brennstoffzellen
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE optimieren die Großserienfertigung von Protonen-Austausch-Membran (PEM)-Brennstoffzellen. Im Rahmen des Projektverbunds »TiKaBe« entwickeln sie innovative Katalysatortinten, die für unterschiedliche industrielle Beschichtungsverfahren verwendet werden können. Die Verkürzung und Vereinfachung des sogenannten Break-In, der Erstkonditionierung von Brennstoffzellen, steht im Mittelpunkt des Forschungsprojekts »BI-FIT« Aktuelle Einblicke in diese Forschung geben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer ISE im Konferenzprogramm der hy-fcell vom 13. bis 14. September 2023 in Stuttgart. Auf dem Stand 4D55, zeigt das Institut Membran-Elektroden-Einheiten (MEAs) für Schwerlastanwendungen und veranschaulicht die Charakterisierung von Zellkomponenten und Lebensdaueruntersuchungen.
Solarzellen in Motorhauben von PKWs integriert
In den letzten Jahren präsentierten bereits einige Autohersteller erste Fahrzeug-Modelle mit integrierter Photovoltaik im Dach. Das Fahrzeugdach ist die am einfachsten nutzbare Fläche für die Erzeugung von Solarstrom an Bord. Forscherinnen und Forscher des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE gingen nun einen Schritt weiter. Im Rahmen zweier öffentlich geförderter Forschungsprojekte integrierten sie Solarzellen in die Standard-Blechmotorhaube eines PKWs. In Kombination mit der MorphoColor® Technologie des Forschungsinstituts kann die solaraktive Fläche der Farbe des Autos angepasst werden. Besucherinnen und Besucher der IAA MOBILITY können die Photovoltaik-Motorhaube vom 5.-11. September 2023 auf dem Fraunhofer Messestand (Halle B1.D11) in München besichtigen.
Expertenrat für Klimafragen stellt Bericht zum Klimaschutzprogramm vor
Am 22. August hat der Expertenrat für Klimafragen seine Stellungnahme zum Klimaschutzprogramm 2023 der Bundesregierung veröffentlicht. Der im September 2020 berufene Expertenrat berät die Bundesregierung bei der Anwendung des Bundes-Klimaschutzgesetzes. Das unabhängige Expertengremium setzt sich aus fünf Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, Vorsitzender ist Prof. Dr. Hans-Martin Henning, Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE und Professor für Solare Energiesysteme an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Zusätzliche Maßnahmen zum Erreichen der Klimaziele notwendig
Der vom Umweltbundesamt (UBA) koordinierte Projektionsbericht 2023 der Bundesregierung analysiert die aktuelle Klimaschutzpolitik. Der Bericht zeigt, dass das Erreichen der nationalen Klimaziele bis 2030 und 2045 ohne zusätzliche Maßnahmen gefährdet ist. Auch wenn die Gesamtlücke im Vergleich zur vorherigen Projektion um 70 Prozent reduziert werden konnte, beträgt sie bis zum Jahr 2030 immer noch 331 Mio. Tonnen klimaschädliche Treibhausgasemissionen. Die Lücke wird auch durch bereits geplante Maßnahmen nicht vollständig geschlossen. Das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 würde unter den gegebenen Umständen nicht erreicht.
Agri-PV in Italien: 593 Megawatt genehmigt
Agri-Photovoltaik (PV) gewinnt durch die dem Klimawandel zugeordneten Veränderungen von Witterung und Niederschlagsmengen rasant an Bedeutung. Derzeit etablieren sich einige Länder als Vorreiter bei ihrer Anwendung und treiben die weitreichende Implementierung der Agri-PV dynamisch voran. Italien gehört zu diesem Kreis: Mit einem staatlichen Förderprogramm sowie Genehmigungsverfahren im Eiltempo gibt das Land derzeit ein Beispiel für die Umsetzung der dualen Flächennutzungstechnologie ab.
Deutschland und Südafrika unterzeichnen Kooperationsvereinbarung für grünen Wasserstoff
Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck und Dr. Kgosientsho Ramokgopa, Minister für Elektrizität im Präsidialamt Südafrikas, haben am Rande der binationalen Kommission zwischen Deutschland und Südafrika am 27. Juni eine Absichtserklärung unterzeichnet, um die Kooperation zu grünem Wasserstoff und Power-to-X Produkten weiter auszubauen.
Veranstaltungshinweis: Workshops in Jena und Ilmenau „Horizon Europe und weitere internationale Förderprogramme – Ihre Unterstützung vor Ort“
Die EU-Förderstruktur wird oft als „sehr komplex“ und „schwer durchschaubar“ beschrieben. Das Team des EEN Thüringen kann Ihnen einen Teil dieser Sorgen nehmen. Das EEN Thüringen hat täglich mit diesem und anderen internationalen Programmen zu tun.
Am 06.09.2023 in Jena und am 26.09.2023 in Ilmenau bietet das EEN Thüringen-Team zwei Workshops zu europäischen und internationalen Förderprogrammen an. Im Mittelpunkt steht das Programm Horizon Europe mit seinen drei Säulen, aber auch andere Förderprogramme für internationale Zusammenarbeit. Im Anschluss an die Vorträge der Nationalen Kontaktstellen für Horizon Europe besteht die Möglichkeit zur individuellen Beratung.
Wasserstoff für den Mittelstand
Mittelstandsbeauftragter Kellner berät mit über 50 Verbänden Maßnahmen zur Umstellung auf neue klimaneutrale Energieträger
Der Parlamentarische Staatssekretär und Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Michael Kellner, hat heute mit über fünfzig Verbänden der mittelständischen Wirtschaft den Dialog- und Arbeitsprozess „Mittelstand, Klimaschutz und Transformation“ fortgesetzt. Im Mittelpunkt stand die zukünftige Produktion und Bereitstellung von Wasserstoff für mittelständische Unternehmen.
Bundeswirtschaftsminister Habeck bei Bosch: Förderbescheid für wichtiges Wasserstoffprojekt in Höhe von rund 161 Millionen Euro übergeben
Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck ist heute aus Anlass seiner Sommerreise bei Bosch in Renningen. Gemeinsam mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, der baden-württembergischen Umweltministerin Thekla Walker und der bayerischen Staatsministerin Melanie Huml übergibt Minister Habeck am Bosch-Forschungscampus in Renningen einen Förderbescheid in Höhe von rund 161 Millionen Euro für ein wichtiges Wasserstoffprojekt.
Fernleitungsnetzbetreiber veröffentlichen Planungsstand für deutschlandweites Wasserstoff-Kernnetz – Erster wichtiger Schritt für die künftige Wasserstoff-Infrastruktur
Die Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) haben ihren aktuellen Planungsstand für das künftige überregionale Wasserstoff-Kernnetz an das BMWK und die Bundesnetzagentur übergeben. Damit ist ein erster wichtiger Schritt für die Planung des Wasserstoffnetzes in Deutschland getan. Wasserstoff ist zentral, um wichtige Industriezweige auf dem Weg zur Klimaneutralität zu dekarbonisieren. Daher muss auch die notwendige Infrastruktur von Anfang an mitgedacht werden.
<< Zurück zu "Alle Meldungen"